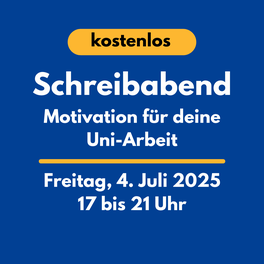So triffst du die beste Wahl, wenn du ein Lexikon zitieren möchtest (zum Beispiel für eine Begriffsdefinition).
Wenn du gerade an deiner wissenschaftlichen Arbeit sitzt und nach Begriffsdefinitionen oder Hintergrundinformationen suchst, ist es verlockend, das erstbeste Lexikon heranzuziehen und zu zitieren.
Doch Vorsicht: Nicht jedes Lexikon eignet sich gleichermaßen gut für deine Uni-Arbeit. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen, um die bestmögliche Quelle für deine Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Dissertation zu finden.

In diesem Artikel erkläre ich dir, worauf du achten solltest, wenn du nach einem Lexikon suchst. Am Ende möchte ich noch meine ganz persönlichen Erfahrungen aus Studienzeiten und als Wissenschaftlerin zur Lexikonsuche mit dir teilen.
Vorab meine Faustregel:
Zitiere immer das bestmögliche Lexikon.
So erkennst du ein qualitätvolles Lexikon
1. Speziallexika sind besser als allgemeine Nachschlagewerke
Ein gutes Lexikon ist meist ein Speziallexikon, das sich einem bestimmten Fachgebiet widmet und innerhalb des Fachgebietes vielleicht sogar nochmals einen weiteren Schwerpunkt hat. Je enger der Fokus des Lexikons ist, desto besser sind Inhalte auf dein Thema abgestimmt.
So kann dir etwa ein allgemeines kunsthistorisches Lexikon, das den gesamten Fachbereich abdeckt, durchaus nützliche biografische Informationen zu einem Künstler liefern, detailliertere und spezifischere Inhalte wirst du aber in einem eigenen Künstlerlexikon finden. Und diese Tiefe ist genau das, was du für eine fundierte wissenschaftliche Arbeit benötigst!
Weiter geht es daher in Sachen Tiefe!
2. Der Umfang als Qualitätsmerkmal eines Lexikons
Ein einbändiges Lexikon mag dir zwar kompakt und praktisch erscheinen, aber es kann dir in der Regel nicht die Tiefe eines mehrbändigen Lexikons bieten.
Bleiben wir beim Beispiel des Künstlerlexikons: Hier ist klar, dass in einem dreißigbändigen Künstlerlexikon nicht nur mehr Künstlerinnen und Künstler behandelt werden als in einem einbändigen, sondern dass die Artikel auch deutlich länger sein werden.
3. Onlinelexikon versus Printlexikon?
Für die Frage, nach welchem Lexikon du greifst, ist das Erscheinungsmedium irrelevant.
Klar sind Onlinelexika leicht verfügbar und leicht zu durchsuchen. Für deine Uni-Arbeit solltest du aber immer das beste Lexikon heranziehen, auch wenn du dafür vielleicht in eine Bibliothek gehen musst.
Umfassende Printlexika stehen übrigens in der Regel im Freihandbereich in den Lesesälen der großen wissenschaftlichen Bibliotheken auf und sind damit leicht zugänglich.
4. Aktualität
Achte darauf, wann das Lexikon, das du nutzt, erschienen ist bzw. ob es regelmäßig aktualisiert wird, was ja bei einem Onlinelexikon möglich ist. Gerade in Fachbereichen, in denen es laufend enormen Wissenszuwachs gibt, ist es wichtig, dass das Lexikon möglichst aktuell ist.
5. Ein Autorenteam sorgt für mehr Qualität als eine Einzelperson
Schau bitte auf jeden Fall auch mal, wer denn das Lexikon verfasst hat, das du zitieren möchtest. Hat eine einzelne Person alle Artikel geschrieben oder ist jeder Artikel namentlich gekennzeichnet, weil ein Autorenteam hinter dem Lexikon steht? Es liegt auf der Hand, dass eine Einzelperson niemals so viel Wissen hat wie ein Autorenkollektiv.
Qualitätvolle Lexika zeichnen sich dadurch aus, dass jeder Artikel von einer Expertin oder einem Experten verfasst wurde (die oder der übrigens häufig auch schon allerhand zu dem Thema des Artikels veröffentlicht hat).
6. Bibliografische Angaben am Ende des Artikels
In einem Lexikon arbeitet man in der Regel nicht mit Belegen, in einem qualitätvollen Lexikon findest du aber oft am Ende des Artikels Literaturangaben. Die können sehr ausführlich sein und zeichnen eben ein gutes Lexikon aus.
Okay, das waren viele Infos. Daher nun eine Zusammenfassung und dann erzähle ich dir noch von meinen persönlichen Erfahrungen.
Zusammenfassung
Ein gutes, also zitierfähiges Lexikon für deine Uni-Arbeit erkennst du an folgenden Punkten:
- Es ist ein Speziallexikon, das sich auf dein Fachgebiet fokussiert.
- Es hat wahrscheinlich mehrere Bände.
- Die Artikel wurden von einem Autorenteam und nicht von einer Einzelperson verfasst. Die einzelnen Artikel sind also namentlich abgezeichnet (und dann übrigens auch wie eine unselbstständige Publikation zu zitieren).
- Die Artikel sind möglichst aktuell.
- Die Artikel handeln das Thema umfassend ab und sind daher länger.
- Die Artikel führen am Ende weitere Literatur an.
Natürlich wirst du nicht zu jedem Thema ein Lexikon finden, das all diese Qualitätskriterien erfüllt, aber es zahlt sich aus, ein wenig zu recherchieren und zu schauen, welches Lexikon du heranziehst.
Meine eigenen Erfahrungen
1. Was ich im Studium wann und wo gelernt habe

Wie du vielleicht weißt, habe ich BWL und Kunstgeschichte studiert (zu meiner Über-mich-Seite). Im Rahmen meines BWL-Studiums habe ich leider wenig zum Thema „Literaturrecherche und Literaturauswahl“ gelernt. Über Lexika haben wir, soweit ich mich erinnere, nie gesprochen.
Anders bei der Kunstgeschichte: Da wusste ich bereits nach ein paar Semestern genau, welche Lexika es gibt und wann ich zu welchem greifen musste. Dieses Wissen hat mir dann meine ganze Studienzeit hindurch und natürlich auch als Wissenschaftlerin Sicherheit gegeben.
Es zahlt sich aus, das Handwerk des wissenschaftlichen Arbeitens zu lernen. Der Umgang mit Lexika zählt dazu.
Und wenn dir deine Hochschule dieses Handwerk nicht oder nur teilweise vermittelt, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, dir dieses Wissen zu holen. In meinem Newsletter bekommst du dazu regelmäßig Tipps. Mein Blog umfasst inzwischen mehr als 300 Artikel zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben.
2. Meine Erfahrungen als Wissenschaftlerin
Noch während meines Kunstgeschichtsstudiums hat es mich in die Wissenschaft verschlagen; ich habe an einem kunsthistorischen Forschungsprojekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mitgearbeitet, und das mit großer Freude.
Als ich dann über den Barockbaumeister Jakob Prandtauer im Rahmen einer Assistentenstelle an der Universität Wien promoviert habe, wurde ich mehrfach gebeten, für verschiedene Lexika Artikel über den Künstler zu schreiben (siehe meine Publikationsliste).
Warum? Weil ich eben die Expertin für das Thema war. Allerdings kann es selbst als Expertin ganz schön herausfordernd sein, einen solchen Artikel zu verfassen. Denn das Expertenwissen muss am Ende doch wieder kompakt aufbereitet werden.
Zum Schluss noch ein paar Worte zum Duden und zu Wikipedia
Viele Studierende zitieren gerne mal den Duden, wenn es um die Definition von Begriffen geht, weil er online verfügbar ist. Ich denke, nach diesem Blogartikel ist klar, dass der Duden in diesen Fällen keine geeignete Referenz ist.
Und Wikipedia, als umfassende Online-Enzyklopädie, kann für dich natürlich eine erste nützliche Anlaufstelle sein. Zitieren solltest du einen Wikipedia-Artikel aber nur, wenn es zu dem Thema keine besseren und wissenschaftlichen Quellen gibt, was selten der Fall ist.
Trage dich in meinen Newsletter ein und hole dir mein kostenloses E-Book mit Tipps für das Abstract, das Vorwort, die Einleitung und die Zusammenfassung!
Veröffentlicht am 4.12.2024.
Abbildungsnachweis: Bild oben (Bücher): Shutterstock.com, Stock Photo ID: 509582818, Billion Photos; Bild unten (Huberta Weigl): andrea sojka fotografie